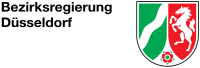Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - Drohnen
Unbemannte Luftfahrzeugsysteme, besser bekannt als Drohnen, eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Zugleich müssen viele Aspekte und Regelungen beachtet werden.
FAQ – Häufig gestellte Fragen und Antworten
EU-Recht
Maßgeblich für die Nutzung von Drohnen sind im Wesentlichen die Durchführungsverordnung DVO (EU) 2019/947 (Regelungen zum Betrieb von Drohnen) sowie die Delegierte Verordnung VO (EU) 2019/945. Letztere enthält die Technischen Anforderungen sowie die Zuordnungskriterien für verschiedene Risikoklassen. Diese Verordnungen sind zum 31.12.2020 in Kraft getreten und haben automatisch anderweitiges nationales Recht verdrängt. Nicht verdrängtes nationales Recht bleibt, solange es nicht geändert wird, gültig.
Grundsätzlich wird mit dem EU-Recht ein risikobasierter Ansatz verfolgt. Das heißt, mit zunehmendem Risiko steigen die Anforderungen an die Ausstattung der Drohnen, die Kenntnisse der Piloten und die Einsatzbereiche.
Nationale Regelungen
Die nationalen Regelungen zum Drohnenbetrieb finden sich hauptsächlich in den §§ 21a bis 21k Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO).
Die DVO (EU) 2019 /947 regelt den Betrieb von Drohnen. Abhängig von der Startmasse der eingesetzten Drohne, der Flughöhe, dem Einsatzort etc. ist zu prüfen, ob es sich noch um einen erlaubnisfreien Betrieb in der „offenen Kategorie“ gemäß Artikel 4 DVO (EU) 2019/947 handelt, oder ob dieser bereits in die „spezielle“ Kategorie gemäß Artikel 5 DVO (EU) 2019/947 fällt und somit einer Erlaubnis bedarf. Einsätze mit besonders hohem Risikopotenzial gehören zur „zulassungspflichtigen“ Kategorie gemäß Artikel 6 DVO (EU) 2019/947.
„Offene“ Kategorie
In der offenen Kategorie kann unter Beachtung der grundsätzlichen Anforderungen
• maximale Flughöhe 120 m,
• nur innerhalb der Sichtweite,
• nicht über Menschenansammlungen,
• max. Gewicht unter 25 kg,
• kein Abwurf von Gegenständen,
• kein Transport von gefährlichen Gegenständen
in den drei Unterkategorien A1, A2 und A3 ohne Erlaubnis geflogen werden.
Entsprechend des beabsichtigten Flugbetriebes gelten hier unterschiedliche Anforderungen im Hinblick auf den Fernpiloten, Abstände zu unbeteiligten Personen, mögliche Flugbereiche und einsetzbare Drohnen. Die Kriterien für einen genehmigungsfreien Flugbetrieb in den Unterkategorien A1 bis A3 finden Sie im Anhang, Teil A zur DVO (EU) 2019/947.
„Spezielle“ Kategorie
Lässt sich der beabsichtigte Flugbetrieb nicht in der offenen Kategorie durchführen, kann er möglicherweise in der speziellen Kategorie abgewickelt werden.
Hierzu ist entweder eine Betriebsgenehmigung erforderlich oder eine Declaration (Erklärung) zu festgelegten Standardszenarien abzugeben.
Zuständig für die Erteilung der Genehmigungen oder die Entgegennahme der Declarations ist das Luftfahrt-Bundesamt, 33144 Braunschweig.
„Zulassungspflichtige“ Kategorie
Zulassungspflichtige Drohnen und deren Betreiber unterliegen einem aufwendigen Zulassungsverfahren. In diese Kategorie fallen u. a. Personentransporte und der Betrieb von Lastendrohnen.
Zuständig für das entsprechende Zulassungsverfahren ist ebenfalls das Luftfahrt-Bundesamt, 33144 Braunschweig.
§ 21h Absatz 3 LuftVO regelt, unter welchen Voraussetzungen der Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugsystemen in sogenannten geografischen Gebieten zulässig ist. Falls der Betrieb abweichend von diesen Voraussetzungen durchgeführt werden soll, kann hierfür auf Antrag eine Genehmigung gemäß § 21i LuftVO erteilt werden.
Nach den Regelungen des § 21h Abs. 3 LuftVO ist der Betrieb in folgenden Gebieten unter den jeweils genannten Voraussetzungen zulässig:
- Über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 1,5 km von der Begrenzung von Flugplätzen, die keine Flughäfen sind, wenn der Betrieb in der „speziellen“ Kategorie stattfindet, oder die Zustimmung der Luftaufsichtsstelle, der Flugleitung oder des Betreibers am Flugplatz eingeholt worden ist,
- über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 1000 Metern von der Begrenzung von Flughäfen sowie innerhalb einer seitlichen Entfernung von weniger als 1000 Metern aller in beide An- und Abflugrichtungen um jeweils 5 Kilometer verlängerten Bahnmittellinien von Flughäfen, wenn der Betrieb in der „speziellen“ Kategorie stattfindet [Hinweis: Dies gilt in Nordrhein-Westfalen nur für den Flughafen Siegerland. Bei allen anderen Flughäfen genügt eine Freigabe der zuständigen Flugverkehrskontrollstelle (siehe Punkt 9.)],
- über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 100 Metern von der Begrenzung von Industrieanlagen, Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen des Maßregelvollzugs, militärischen Anlagen und Organisationen, Anlagen der zentralen Energieerzeugung und Energieverteilung, sowie Einrichtungen, in denen erlaubnisbedürftige Tätigkeiten der Schutzstufe 4 nach der Biostoffverordnung ausgeübt werden, wenn die zuständige Stelle oder der Betreiber der Einrichtungen dem Betrieb des unbemannten Fluggerätes ausdrücklich zugestimmt hat. Anlagen der zentralen Energieerzeugung sind all diejenigen an das Verteilernetz angeschlossene Energieerzeugungsanlagen, die keine dezentrale Erzeugungsanlage im Sinne des § 3 Nummer 11 EnWG sind,
- über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 100 Metern von Grundstücken, auf denen die Verfassungsorgane des Bundes oder der Länder oder oberste und obere Bundes- oder Landesbehörden oder diplomatische und konsularische Vertretungen sowie internationale Organisationen im Sinne des Völkerrechts ihren Sitz haben sowie von Liegenschaften von Polizei und anderen Sicherheitsbehörden, wenn die zuständige Stelle oder der Betreiber der Einrichtungen dem Betrieb des unbemannten Fluggerätes ausdrücklich zugestimmt hat,
- über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 100 Metern von Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Bahnanlagen,
a) wenn im Falle eines Überflugs von Bundesfernstraßen oder Bahnanlagen der Betrieb in der „speziellen“ Kategorie stattfindet und die besonderen Gefahren des Überflugs von Bundesfernstraßen oder Bahnanlagen innerhalb der Risikobewertung gemäß Artikel 11 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 ausreichend berücksichtigt wurden,
b) wenn die zuständige Stelle oder der Betreiber der Einrichtungen dem Betrieb des unbemannten Fluggerätes ausdrücklich zugestimmt hat,
c) wenn die Höhe des Fluggerätes über Grund stets kleiner ist als der seitliche Abstand zur Infrastruktur und der seitliche Abstand zur Infrastruktur stets größer als 10 Meter ist, oder
d) wenn im Falle eines Überflugs von Bundeswasserstraßen das Fluggerät mindestens 100 Meter über Grund oder Wasser betrieben wird, lediglich eine Querung auf dem kürzesten Wege erfolgt, und keine Schiffe und keine Schifffahrtsanlagen, insbesondere Schleusen, Wehre, Schiffshebewerke und Liegestellen, überflogen werden,
- über Naturschutzgebieten im Sinne des § 23 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes, über Nationalparks im Sinne des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes und über Gebieten im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 6 und 7 des Bundesnaturschutzgesetzes, wenn die zuständige Naturschutzbehörde dem Betrieb ausdrücklich zugestimmt hat, der Betrieb von unbemannten Fluggeräten in diesen Gebieten nach landesrechtlichen Vorschriften abweichend geregelt ist, oder, mit Ausnahme von Nationalparks,
a) wenn der Betrieb nicht zu Zwecken des Sports oder der Freizeitgestaltung erfolgt,
b) in einer Höhe von mehr als 100 Metern stattfindet,
c) der Fernpilot den Schutzzweck des betroffenen Schutzgebietes kennt und diesen in angemessener Weise berücksichtigt und
d)die Luftraumnutzung durch den Überflug über dem betroffenen Schutzgebiet zur Erfüllung des Zwecks für den Betrieb unumgänglich erforderlich ist,
- über Wohngrundstücken, wenn
a) der durch den Betrieb über dem jeweiligen Wohngrundstück in seinen Rechten betroffene Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte dem Überflug ausdrücklich zugestimmt hat, oder
b) die Startmasse des unbemannten Fluggerätes bis zu 0,25 Kilogramm beträgt und das unbemannte Fluggerät und seine Ausrüstung zu optischen und akustischen Aufzeichnungen und Übertragungen sowie zur Aufzeichnung und zur Übertragung von Funksignalen Dritter nicht in der Lage sind, oder
c) der Betrieb in einer Flughöhe von mindestens 100 Metern stattfindet, und
aa) die Luftraumnutzung über dem betroffenen Wohngrundstück zur Erfüllung eines berechtigten Betriebszwecks erforderlich ist, öffentliche Flächen oder Grundstücke, die keine Wohngrundstücke sind, für den Überflug nicht genutzt werden können, und die Zustimmung des Grundstückseigentümers oder sonstigen Nutzungsberechtigten nicht in zumutbarer Weise eingeholt werden kann,
bb) alle Vorkehrungen getroffen werden, um einen Eingriff in den geschützten Privatbereich und in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der betroffenen Bürger zu vermeiden. Dazu zählt insbesondere, dass in ihren Rechten Betroffene regelmäßig vorab zu informieren sind,
cc) der Betrieb nicht zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr Ortszeit stattfindet und
dd) nicht zu erwarten ist, dass durch den Betrieb Immissionsrichtwerte nach Nummer 6.1 der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm überschritten werden,
- über Freibädern, Badestränden und ähnlichen Einrichtungen außerhalb der Betriebs- oder Badezeiten,
- in Kontrollzonen, wenn eine Flugverkehrskontrollfreigabe gemäß § 21 eingeholt wurde,
- über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 100 Metern von der Begrenzung von Krankenhäusern, wenn der Betreiber der Einrichtungen dem Betrieb des unbemannten Fluggerätes ausdrücklich zugestimmt hat,
- über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 100 Metern von Unfallorten und Einsatzorten von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie über mobilen Einrichtungen und Truppen der Streitkräfte im Rahmen angemeldeter Manöver und Übungen, wenn der zuständige Einsatzleiter dem Betrieb zustimmt.
Allgemeine und projektbezogen Genehmigungen
Erlaubnisse können allgemein, d. h. mit einer Gültigkeit von zwei Jahren in ganz Nordrhein-Westfalen, oder projektbezogen, d. h. für einen vorher festgelegten Aufstiegsort und zeitlich auf wenige Tage beschränkt, erteilt werden.
Die Genehmigungen werden unter bestimmten Auflagen erteilt. Abweichungen von diesen Nebenbestimmungen oder Ausnahmen von Verboten, die hier nicht aufgeführt sind, müssen im Einzelfall geprüft werden. Den Wortlaut der im Regelfall in die Genehmigung aufzunehmenden Nebenbestimmungen finden sie hier.
Zuständigkeit
Zuständige Behörde für die Erteilung der Genehmigung ist die örtlich zuständige Luftfahrtbehörde des jeweiligen Bundeslandes. In Nordrhein-Westfalen sind dies für die Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf die Bezirksregierung Düsseldorf und für die Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und Münster die Bezirksregierung Münster.
Bei allgemeinen Genehmigungen richtet sich die Zuständigkeit nach dem Unternehmenssitz bzw. bei Privatpersonen nach dem Wohnsitz. Bei projektbezogenen Genehmigungen richtet sich die Zuständigkeit nach dem Ort, an dem der Betrieb des unbemannten Fluggeräts stattfinden soll.
Antragsformular
Genehmigungen können mit dem folgenden Formular beantragt werden:
Es genügt eine Übermittlung mit den im Antragsvordruck aufgeführten Unterlagen per E-Mail. Eine postalische Nachsendung ist nicht erforderlich.
Bearbeitungszeit
Der Antrag sollte rechtzeitig gestellt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Bearbeitungszeit bei vollständig vorliegenden Anträgen in der Regel etwa zwei Wochen in Anspruch nimmt. Die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Betriebs- und Ausnahmeerlaubnissen im Einzelfall kann – abhängig von den Rahmenbedingungen – mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Gebühren
Für die Antragsbearbeitung werden folgende Gebühren erhoben:
Allgemeine Genehmigung:
- Ein Tatbestand: 200,- Euro
- Jeder weitere Tatbestand: 150,- Euro
Einzelfall- bzw. projektbezogene Betriebserlaubnis:
- Ein Tatbestand: 75,- €
- Jeder weitere Tatbestand: 50,- €
- Die Gebühr kann sich bei Vorliegen mehrerer Aufstiegsorte oder -termine erhöhen.
Änderung einer bestehenden Erlaubnis (z. B. Aufnahme zusätzliche Steuerer): 50,- €
Als Tatbestand gilt jeder unter Ziffer 4. des Antragsformulars angegebene Punkt.
Bei der Anschaffung und beim Einsatz von Drohnen sollte darauf geachtet werden, ob und wie diese klassifiziert sind, da hiervon u. a. abhängig ist, welche Kompetenznachweise die Fernpiloten benötigen oder in welchen Bereichen der Betrieb in der Kategorie „offen“ überhaupt zulässig ist.
Klassifizierte Fluggeräte
Neu auf den Markt gebrachte Drohnen verfügen in der Regel über eine Klassifizierung C0, C1, C2 oder C3, die sich hauptsächlich nach der Startmasse richtet. Eine entsprechende Plakette auf der Drohne gibt an, welcher Klasse diese zugeordnet ist. Je nach Klasse dürfen die Drohnen in der Unterkategorie A1, A2 oder A3 in der Betriebskategorie „offen“ eingesetzt werden. Die besonderen Anforderungen und Einschränkungen der einzelnen Unterkategorien sind in den Punkten UAS.OPEN.020 (A1), UAS.OPEN.030 (A2) und UAS.OPEN.040 (A3) in Teil A des Anhangs zur Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 beschrieben.
Nicht klassifizierte Fluggeräte
Seit dem 01.01.2024 dürfen „Bestandsdrohnen“, d. h. Fluggeräte, die nicht nach den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 2019/945 hergestellt und vor dem 01.01.2024 in Verkehr gebracht wurden, gemäß Artikel 20 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 nur noch unter folgenden Bedingungen genutzt werden: Bei einer Startmasse von unter 250 g fällt der Betrieb in die Unterkategorie A1, bei einer Startmasse von 250 g bis unter 25 kg sind die Vorgaben der Unterkategorie A3 zu beachten. Die gleichen Vorgaben gelten auch für privat hergestellte Fluggeräte.
Nachträgliche Klassifizierung
Teilweise können auch „Bestandsdrohnen“ noch nachträglich eine Klassifizierung erhalten. Hierzu wenden Sie sich bitte an den Hersteller, der Ihnen Auskunft geben kann, ob für das jeweils genutzte Modell diese Möglichkeit besteht und welche Maßnahmen hierfür durchgeführt werden müssen. Wenn das Verfahren erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Plakette mit Angabe der Klasse, die Sie auf dem Fluggerät anbringen müssen. Falls keine nachträgliche Klassifizierung möglich ist, dürfen die Fluggeräte weiterhin nur nach den Vorgaben für nicht klassifizierte Fluggeräte betrieben werden.
Übersicht zu den erforderlichen Kompetenznachweisen und einzuhaltenden Abständen abhängig von der Startmasse oder der Klassifizierung der Drohne
| Drohnen | Startmasse | Kompetenznachweis | unbeteiligte Personen* | Wohn-, Gewerbe-, Industrie- gebiete |
| Klasse C0 | < 250 g | nicht erforderlich | dürfen überflogen werden | kein Abstand |
| Klasse C1 | 250 g bis < 900 g | A1/A3 | ein Überflug soll vermieden werden | kein Abstand |
| Klasse C2 | 900 g bis < 4 kg | A1/A3 | nach vernünftigem Ermessen werden keine unbeteiligten Personen gefährdet | seitlicher Abstand mind. 150 m |
| A2 | seitlicher Abstand 30 m, im Langsamflugmodus 5 m | kein Abstand | ||
| Klasse C3 / C4 | 4 kg bis < 25 kg | A1/A3 | nach vernünftigem Ermessen werden keine unbeteiligten Personen gefährdet | seitlicher Abstand mind. 150 m |
| selbst hergestellte oder nicht nachklassifizierte "Bestandsdrohnen" | < 250 g | nicht erforderlich | dürfen überflogen werden | kein Abstand |
| 250 g bis < 25 kg | A1/A3 | nach vernünftigem Ermessen werden keine unbeteiligten Personen gefährdet | seitlicher Abstand mind. 150 m |
* Gilt nur für einzelne Personen. Für den Betrieb über Menschenansammlungen im Sinne des Art. 2 Nr. 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 ist immer eine Genehmigung für die Betriebskategorie „speziell“ erforderlich.
Registrierungspflicht
Als Betreiber einer Drohne müssen Sie sich registrieren. Betreiben Sie als Angehöriger einer juristischen Person (z. B. einer GmbH) eine Drohne, muss die Drohne auf die juristische Person registriert sein. Betreiben Sie als natürliche Person eine Drohne müssen Sie sich persönlich registrieren.
Die Registrierungspflicht gilt, wenn
- die maximale Startmasse der Drohne 250 g oder mehr beträgt oder
- die Drohne (unabhängig vom Startgewicht) mit einem Sensor ausgerüstet ist, der personenbezogene Daten erfassen kann (z. B. einer Kamera) und die Drohne kein Spielzeug gemäß der europäischen Richtlinie 2009/48/EG ist.
Die Registrierung muss in dem Land erfolgen, in dem Sie als natürliche Person Ihren Wohnsitz bzw. als juristische Person Ihren Hauptgeschäftssitz haben. Die Registrierungsmöglichkeit für Deutschland stellt das Luftfahrt-Bundesamt in digitaler Form bereit.
Sie erhalten nach der Registrierung eine individuelle Registrierungsnummer, die Sie auf jeder von Ihnen betriebenen Drohne anbringen bzw. in das Fernidentifikationssystem der jeweiligen Drohne hochladen müssen. Diese Registrierungsnummer gilt in allen EASA-Mitgliedsstaaten.
Weitere Informationen zur Betreiberregistrierung finden Sie auf der Internetseite des Luftfahrt-Bundesamts.
Kenntnisnachweise
Abhängig von der in der offenen Kategorie möglichen Betriebsart (Unterkategorie A1, A2 oder A3) sind zwei unterschiedliche Kenntnisnachweise erforderlich. Lediglich für Drohnen unter 250 g (Risikoklasse C0) ist kein EU-Kenntnismachweis erforderlich.
Für den Betrieb von Drohnen gemäß Unterkategorie A1 und/oder A3 wird ein Fernpilotennachweis vorausgesetzt. Dazu ist ein Online-Lehrgang mit abschließender Online-Prüfung von Theoriekenntnissen erforderlich. Die Online-Prüfung wird vom Luftfahrt-Bundesamt bereitgestellt und umfasst die im Anhang zur DVO (EU) 2019/947, Teil A unter Punkt UAS.OPEN.020 aufgeführten Sachgebiete.
Für den Betrieb gemäß Unterkategorie A2 (nur möglich mit einer Drohne der Risikoklasse C2 mit eingeschalteter und aktualisiertem System für direkte Fernidentifizierung und Geo-Sensibilisierungsfunktion) ist ein Kompetenznachweis in Form eines Fernpiloten-Zeugnisses erforderlich. Das Zeugnis wird vom Luftfahrt-Bundesamt bzw. einer für diese Zwecke vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannten Stelle ausgestellt. Die Voraussetzungen gemäß Anhang zur DVO (EU) 2019/947, Teil A unter Punkt UAS.OPEN.030 Unterpunkt 2. sind
- der Abschluss eines Online-Lehrgangs und das Bestehen der dazu gehörigen Online-Theorieprüfung (Fernpilotennachweis, wie oben beschrieben)
- Abschluss eines praktischen Selbststudiums (Trainingsflüge) in einer Betriebsumgebung gemäß Unterkategorie A3 (keine Gefährdung unbeteiligter Personen, 150 m horizontaler Abstand zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten)
- Erklärung über den Abschluss des praktischen Selbststudiums und Bestehen einer zusätzlichen Theorieprüfung beim Luftfahrt-Bundesamt bzw. einer von dort anerkannten Stelle mit Fragen zu den Sachgebieten „Meteorologie“, „UAS-Flugleistung“ sowie „technische und betriebliche Minderung von Risiken am Boden“.
Weitere Informationen zu den Kenntnisnachweisen finden Sie auf der Internetseite des Luftfahrt-Bundesamts.
Versicherungspflicht
Für die Regulierung von Personen- und Sachschäden muss eine Haftpflichtversicherung nach den Vorschriften §§ 37 Absatz 1a), 43 LuftVG i. V. m. § 101 ff LuftVZO bestehen.
Ein Versicherungsnachweis, aus dem Umfang, Dauer und die maßgebliche Mindestdeckung hervorgehen, ist immer mitzuführen.
Bitte beachten Sie, dass die private Haftpflichtversicherung die Benutzung von Fluggeräten, insbesondere zu gewerblichen Zwecken, häufig nicht abdeckt, und klären Sie dies ggf. mit dem Versicherungsunternehmen.
Sonderregelungen für Behörden und für Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a) der Verordnung (EU) 2018/1139 legt fest, dass diese Verordnung (und damit auch die darauf basierenden VO (EU) 2019/945 und DVO (EU) 2019/947) nicht für Luftfahrzeuge und ihre Motoren, Propeller, Teile, ihre nicht eingebaute Ausrüstung und die Ausrüstung zu Fernsteuerung von Luftfahrzeugen gelten, wenn sie für Tätigkeiten oder Dienste für das Militär, den Zoll, die Polizei, Such- und Rettungsdienste, die Brandbekämpfung, die Grenzkontrolle und Küstenwache oder ähnliche Tätigkeiten oder Dienste eingesetzt werden, die unter der Kontrolle und Verantwortung eines Mitgliedstaats im öffentlichen Interesse von einer mit hoheitlichen Befugnissen ausgestatteten Stelle oder in deren Auftrag durchgeführt werden.
Diese Privilegierung wird in der nationalen Gesetzgebung im § 21 k LuftVO umgesetzt.
Nach aktueller Rechtsauffassung der EASA (und diese ist im Rahmen des Europarechts direkt national wirksam) reicht für die Privilegierung des Artikels 2 Abs. 3 Buchst. a) der VO (EU) 2018/1139 die alleinige Eigenschaft als Behörde oder Organisation mit Sicherheitsaufgaben (BOS), die zudem eng auszulegen ist – so fallen z. B. öffentlich bestellte oder beliehene natürliche oder juristische Personen laut EASA nicht mehr darunter –, nicht aus.
Vielmehr kommt es, als zweite Voraussetzung für die Privilegierung, auch auf die Art und den Zweck des von der Behörde oder in ihrem Auftrag durchgeführten Flugbetriebs an.
Dieser muss im Zusammenhang mit militärischen, zollrechtlichen, polizeilichen, Such- und Rettungs-, Brandbekämpfungs- oder Grenzkontrollaufgaben oder Aufgaben der Küstenwache stehen.
Im Ergebnis fallen Drohnenflüge somit ab sofort nur noch unter die Privilegierung, wenn beide oben beschriebenen Voraussetzungen (BOS-Eigenschaft und legitimierter Einsatzzweck) gegeben sind.
Diese Klarstellung erfolgte durch Mitteilung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr vom 20.07.2022 (Aktenzeichen: PG Unb LF/6312.1/8326.1).
Eine Anpassung des § 21k LuftVO ist angekündigt.
LUC (Betreiberzeugnis für Leicht-UAS)
Juristische Personen können ein sogenanntes LUC beantragen. Dazu sind umfangreiche Voraussetzungen zu erfüllen. Als Inhaber eines Betreiberzeugnisses können Drohnenflüge dann innerhalb der speziellen Kategorie ohne Erlaubnis betrieben werden und unterliegen einem Aufsichtsprogramm.
Zuständig für Auskünfte und entsprechende Antragsverfahren ist das Luftfahrt-Bundesamt, 33144 Braunschweig. Die Rechtsgrundlage für diesen Bereich finden Sie im Teil C der DVO (EU) 2019/947.
Vor dem Start einer Drohne sollte eine angemessene Vorbereitung stattfinden. Hierbei sollte sich der Steuerer mit den technischen Eigenschaften des Fluggerätes (Betriebsgrenzen, Notfallverfahren etc.), den Wetterbedingungen vor Ort und der dort bestehenden Luftraumstruktur (Kontrollzonen, Einschränkungen, aktuelle Informationen über NOTAMs) vertraut machen.
Zudem muss eine Prüfung erfolgen, ob sich zum Aufstiegszeitpunkt eine Menschenansammlung in der Nähe befindet oder in der Umgebung Grundstücke oder Einrichtungen liegen, für die Einschränkungen gemäß § 21h Abs. 3 LuftVO gelten. In diesem Fall sind gegebenenfalls erforderliche Zustimmungen betroffener Stellen rechtzeitig vorher einzuholen.
Zudem sollte der Aufstiegsort in geeigneter Weise abgesichert werden, um eine Störung oder Gefährdung von Unbeteiligten zu vermeiden. Es wird darüber hinaus empfohlen, Anwohner sowie die örtlich zuständige Ordnungsbehörde und/oder Polizeidienststelle über die geplanten Aufstiege zu informieren.
Flugbeschränkungsgebiete und Kontrollzonen
Gemäß § 17 Abs. 2 LuftVO dürfen Flugbeschränkungsgebiete nur mit einer Genehmigung des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung (BAF) durchflogen werden. Informationen zum Genehmigungsverfahren finden Sie auf der Internetseite des BAF.
Gemäß § 21 Abs. 1 LuftVO ist vor der Nutzung des kontrollierten Luftraums um Flugplätze eine Freigabe bei der zuständigen Flugverkehrskontrollstelle einzuholen. Für die zivilen Flughäfen und Flugplätze sind in Nordrhein-Westfalen die Deutsche Flugsicherung oder die DFS Aviation Services zuständig. Diese haben allgemeine Flugverkehrskontrollfreigaben unter bestimmten Voraussetzungen bis zu einer Flughöhe von 50 m über Grund erteilt (s. NfL-2023-1-2705 und NfL-2022-1-2670)
Diese Freigaben gelten jedoch nicht für militärische Flugplätze. Hier ist vor jedem Drohnenbetrieb innerhalb der entsprechenden Kontrollzone unabhängig von der Flughöhe eine Kontrollfreigabe bei der zuständigen Stelle am jeweiligen Flugplatz einzuholen.
Interaktive Karten und Drohnen-Apps
Eine Vielzahl von Unternehmen bietet mittlerweile sogenannte Drohnen-Apps an. In diesen können Sie den geplanten Flugbereich, technische Angaben zum Fluggerät etc. eingeben und erhalten relativ zuverlässige Angaben darüber, was vor und während der Flüge zu beachten ist und ob ggf. vorab Erlaubnisse eingeholt werden müssen. Auch wenn die durch die App erteilten Angaben nicht rechtsverbindlich sind, bieten sie jedoch einen guten Überblick und sind insbesondere für ortsunkundige Drohnennutzer zu empfehlen.
Darüber hinaus hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr auf der Internetseite uas-betrieb.de neben allgemeinen Informationen rund um den Drohnenbetrieb u. a. ein „Map Tool“ bereitgestellt, über das ebenfalls dauerhafte sowie temporäre geografische Einschränkungen angezeigt werden können.
Geofencing
Einige Hersteller statten ihre Fluggeräte technisch so aus, dass diese an den Einflug in bestimmte Bereiche (z. B. die 1,5-km-Grenze um Flugplätze) gehindert werden oder die Fluggeräte in diesen Bereichen nicht aufsteigen oder gar nicht erst in Betrieb genommen werden können. In diesen Fällen muss beim jeweiligen Hersteller eine Freischaltung erfolgen, wofür häufig die von der Luftfahrtbehörde erteilte Betriebs- oder Ausnahmeerlaubnis vorzulegen ist. Bitte informieren Sie sich vorab, ob und ggf. welche „No-Fly-Zones“ bei dem von Ihnen genutzten Fluggerät einprogrammiert sind, und wie viel Vorlaufzeit zusätzlich für eine Freischaltung einzuplanen ist.
Sonstige rechtliche Bestimmungen
Neben den im Luftverkehrsrecht geregelten Pflichten und Verboten sind auch privat- und ggf. strafrechtliche Vorschriften, insbesondere zum Schutz der Privatsphäre, zum Datenschutz, zum Urheberrecht sowie zum Lärm- und Umweltschutz zu beachten.