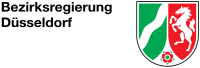Ausbildung zur Fachlehrerin / zum Fachlehrer an Förderschulen
Sie interessieren sich für die Tätigkeit als Fachlehrerin oder Fachlehrer an Förderschulen? Hier finden Sie alle Informationen.
Grundlage dieser Ausbildung ist die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Förderschulen und in der pädagogischen Frühförderung (APO FLFS) vom 25.04.2016 in der zurzeit gültigen Fassung. Die Ausbildung findet an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung statt.
Das Ziel ist, den Teilnehmenden der Ausbildung die fachlichen Voraussetzungen für die erzieherische, pflegerische und unterrichtliche Tätigkeit bei Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung oder für die Tätigkeit in der pädagogischen Frühförderung von Kindern mit einer Hör- oder Sehschädigung zu vermitteln, sie auf diese Tätigkeiten vorzubereiten und sie mit den Aufgaben ihres Berufes vertraut zu machen (§ 1 APO FLFS).
Arbeitsplatz und Aufgabenfelder
Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbildung werden an Förderschulen mit den Förderschwerpunkten „geistige Entwicklung“ oder „Körperliche und motorische Entwicklung“ oder in der vorschulischen Erziehung und Förderung von Kindern mit den Förderschwerpunkten „Sehen“ und „Hören und Kommunikation“ eingesetzt. Sie übernehmen dort Tätigkeiten als Mitglied eines Klassenteams und arbeiten sowohl mit einzelnen Schülerinnen und Schülern, einer Lerngruppe oder der gesamten Klasse. In ihrer Tätigkeit kooperieren sie mit den Lehrerinnen und Lehrern mit dem Lehramt für sonderpädagogische Förderung, weiteren Fachlehrerinnen und Fachlehrern sowie den weiteren Mitgliedern eines Klassenteams.
Entsprechend des hier skizzierten Tätigkeitsfeldes umfasst die Ausbildung ein weites Spektrum. Hierzu gehört u.a.:
- die Auseinandersetzung mit den Förderplänen und Lernbedarfen der jeweiligen Schülerinnen und Schülern,
- die Planung, Durchführung und Reflexion schulpraktischer Tätigkeiten,
- die Erstellung geeigneter Lern- und Arbeitsmittel – vor allem auch im digitalen Bereich,
- die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern/ Erziehungsberechtigten und außerschulischen Einrichtungen,
- das Engagement im System Schule
- etc.
Einstellungstermine
Ob und wann ein Ausbildungsgang angeboten wird, entscheidet das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW (MSB) auf dem Erlasswege. Vorbehaltlich des jeweils regelnden Erlasses wird grundsätzlich eine Einstellung in den Ausbildungsgang zum 01.05. sowie zum 01.11. eines Jahresangestrebt.
Für die Ausbildung sind für die Bezirksregierung Düsseldorf folgende Zentren für Schulpraktische Lehrausbildung vorgesehen:
- ZfsL Düsseldorf Einstellungstermine: 01.05.2025 & 01.11.2026
- ZfsL Kleve Einstellungstermine: 01.11.2025 & 01.05.2027
Bewerbungsverfahren
Das Bewerbungsverfahren startet in der Regel ca. 9 Monate vor Beginn der Ausbildung. Nähere Informationen hinsichtlich Fristen und Ablauf eines Bewerbungsverfahrens sowie die erforderlichen Bewerbungsunterlagen finden Sie zu gegebener Zeit unter https://www.brd.nrw.de/karriere/stellenangebote
unter der Überschrift Ausbildungsangebote der Bezirksregierung.
Beachten Sie bitte, dass es sich bei den Bewerbungsfristen um Ausschlussfristen handelt. Maßgeblich für eine fristgerechte Bewerbung ist der Eingangsstempel der Bezirksregierung. Verspätet eingehende Bewerbungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Beachten Sie bitte weiterhin, dass verspätet eingereichte oder unvollständige Nachweise ebenfalls zur Nichtberücksichtigung Ihrer Bewerbung führen können. Eine rechtliche Verpflichtung, Sie zu benachrichtigen, wenn die Unterlagen fehlerhaft ausgefüllt oder unvollständig sind, besteht nicht.
Weiterführende Informationen
Zum Ausbildungsgang „Fachlehrerin / Fachlehrer an Förderschulen“ kann gem. § 2 APO FLFS zugelassen werden, wer
1. einen mindestens mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) besitzt und
2a) nach Ableisten der in der Fachrichtung vorgeschriebenen Berufsausbildung die Prüfung als Handwerks-, Industrie- oder Hauswirtschaftsmeister/in bestanden hat.
Bewerbungen können nur berücksichtigt werden, wenn die Vorbildung einen Einsatz innerhalb der Fächer Arbeitslehre / Technik, Hauswirtschaft, Textilgestaltung oder Gartenbau ermöglicht.
oder
2b) nach dem Besuch einer Fachschule für Sozialpädagogik die Abschlussprüfung bestanden und danach eine für die Laufbahn förderliche hauptberufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs Monaten ausgeübt hat.
Als gleichwertig anerkannt sind auch:
- Absolventinnen und Absolventen des Studienganges Bachelor – Rehabilitationspädagogik
- akademische Sprachtherapeutin/ akademischer Sprachtherapeut
- Altenpflegerin/ Altenpfleger
- Ergotherapeutin/ Ergotherapeut
- Gebärdendolmetscherin/Gebärdendolmetscher
- Gebärdensprachdozentin/ Gebärdensprachdozent
- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin/ Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
- Gesundheits- und Krankenpflegerin/ Gesundheits- und Krankenpfleger
- Gymnastiklehrerin / Gymnastiklehrer
- Heilerziehungspflegerin/ Heilerziehungspfleger
- Heilpädagogin/ Heilpädagoge
- Kindergärtnerin/ Kindergärtner und Hortnerin / Hortner
- Logopädin/ Logopäde
- Motopädin/ Motopäde
- Pflegefachfrau/ Pflegefachmann
- Physiotherapeutin/ Physiotherapeut
- Sozialpädagogin/ Sozialpädagoge mit staatlicher Anerkennung
- staatlich anerkannte Erzieherin/ Erzieher
Die Anerkennung der genannten Vorbildungen und Prüfungen erfordert jeweils eine mindestens achtzehnmonatige hauptberufliche Tätigkeit an einer Förderschule (hierunter fällt auch die pädagogische Tätigkeit als Integrationshelferin / Integrationshelfer an einer Förderschule), einer Einrichtung für Behinderte (Erziehung oder Rehabilitation) oder an einer integrativen Einrichtung nach Erwerb der Qualifikation.
Zeiten eines Anerkennungsjahres, eines freiwilligen sozialen Jahres, des Zivildienstes oder von Praktika werden nicht berücksichtigt.
Sofern die Anzahl der Bewerbungen die Anzahl der verfügbaren Ausbildungsplätze übersteigt, werden die Bewerbungen nach Art und Dauer der nachzuweisenden laufbahnförderlichen hauptberuflichen Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs Monaten in folgender Reihenfolge berücksichtigt:
a. Tätigkeit, die an einer Förderschule oder einer Schule für Kranke ausgeübt wurde, vorrangig im Schwerpunkt der sonderpädagogischen Förderung Sehen, Hören und Kommunikation, Geistige Entwicklung oder Körperliche und motorische Entwicklung.
b. Tätigkeit, die an einem Ort der sonderpädagogischen Förderung gem. § 2 Abs. 1 AOSF vorrangig im Schwerpunkt der sonderpädagogischen Förderung Sehen, Hören und Kommunikation, Geistige Entwicklung oder Körperliche und motorische Entwicklung ausgeübt wurde,
c. Tätigkeit, die an einer Förderschule oder an einem Ort der sonderpädagogischen Förderung vorrangig im Schwerpunkt der sonderpädagogischen Förderung Sehen, Hören und Kommunikation, Geistige Entwicklung oder Körperliche und motorische Entwicklung gem. § 2 Abs. 1 AO-SF in Verbindung mit einer anderen Tätigkeit als Erzieher/in ausgeübt wurde,
d. Tätigkeit, die mindestens 3 Jahre an einer Einrichtung für Behinderte ausgeübt wurde.
Die Plätze, die nach Berücksichtigung der Bewerbungen gemäß a. bis c. noch verbleiben, werden - unter Berücksichtigung der erforderlichen Mindestdauer der nachzuweisenden Tätigkeit - nach Maßgabe der Dauer der von den Bewerberinnen und Bewerbern nachgewiesenen Tätigkeiten vergeben.
Eine hauptberufliche Tätigkeit ist entgeltlich und muss den überwiegenden Teil der Arbeitskraft beanspruchen (§ 6 Abs. 3 Satz 2 LVO). Hierfür ist in der Regel eine Beschäftigung mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit erforderlich. Der jeweilige Stundenumfang wird bei der Bildung der Rangfolge nicht berücksichtigt.
Ein Einsatz in einer laufbahnförderlichen Tätigkeit mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit im Rahmen einer insgesamt hauptberuflichen Tätigkeit ist entsprechend seines Verhältnisses zur hälftigen Beschäftigung zu berücksichtigen.
Die Ausbildung dauert ein Jahr und sechs Monate. Die Bewerberinnen und Bewerber treten nach der Zulassung durch die Bezirksregierung mit Abschluss eines entsprechenden Vertrages in ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis und führen die Bezeichnung "Fachlehrer(in) in Ausbildung".
Die Ausbildung gliedert sich in einen theoretischen und einen schulpraktischen Bereich.
Die theoretische Ausbildung findet in den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) in Düsseldorf oder Kleve statt. Sie umfasst durchschnittlich 8 Stunden pro Woche, wobei 4 Stunden auf ein Rahmen- und weitere 4 Stunden auf ein Praxisseminar entfallen. Ausbildungsinhalte sind neben Sonderpädagogik (einschließlich Sozialpädagogik), sonderpädagogische Psychologie, Medizinische Aspekte, Schulrecht sowie fachliche und didaktisch-methodische Fragen des Unterrichts und der Erziehung im Hinblick auf das angestrebte Tätigkeitsfeld.
Für die schulpraktische Ausbildung werden die Fachlehrerinnen und Fachlehrer von der Seminarleitung einer Ausbildungsschule zugewiesen (eine Liste der jeweiligen Ausbildungsschulen finden Sie auf den Homepages der Ausbildungsseminare). Die schulpraktische Ausbildung an einer Ausbildungsschule umfasst durchschnittlich 12 Unterrichtsstunden. Die schulpraktische Ausbildung dient der Einübung in die Aufgaben der Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Förderschulen. Dazu gehören auch die Planung, Durchführung und Reflexion schulpraktischer Tätigkeiten in den Bereichen Pflege, Freizeit und Unterricht.
Im Rahmen von Einsichtnahmen in schulpraktische Tätigkeiten (EsT) nehmen die Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder Kenntnis über die Lernentwicklung der Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbildung und beraten sie hinsichtlich des weiteren Professionalisierungsprozesses.
Neben den Tätigkeiten am ZfsL und an der Ausbildungsschule fallen in der Regel weitere Tätigkeiten an, die an der Ausbildungsschule und/ oder zu Hause zu erledigen sind. Hierzu zählen:
- Vor- und Nachbereitung schulpraktischer Tätigkeiten, inkl. Herstellung und Besorgung von Materialien,
- Erstellung und Verschriftlichung von Entwürfen und Berichten zur bzw. über schulpraktische Tätigkeiten,
- Verschriftlichung und Auswertung von Beobachtungen über Schülerinnen und Schüler,
- Teilnahme an Teambesprechungen, Konferenzen, Elternabenden und -gesprächen, Organisation und Teilnahme an Klassenausflügen und -festen, Studium von Fachliteratur, ...
Der Ausbildungsgang schließt mit einer Abschlussprüfung ab, die sich in 3 Abschnitte gliedert:
- eine schriftliche Hausarbeit,
- eine schulpraktische Prüfung, bestehend aus zwei schulpraktischen Proben von je 35 – 50 Minuten Dauer und
- eine mündliche Prüfung von 60 Minuten Dauer.
Über die bestandene Prüfung erhalten die Teilnehmenden ein Zeugnis.
Die angehenden Fachlehrerinnen und Fachlehrer erhalten vom Landesamt für Besoldung für die Dauer der Teilnahme an dem Ausbildungsgang eine Unterhaltsbeihilfe in Höhe der jeweils geltenden Anwärterbezüge der entsprechenden Laufbahngruppe des öffentlichen Dienstes.
(Siehe dazu BASS 21 -23 Nr.1.2 Richtlinien über die Gewährung von Unterhalsbeihilfen an Schulpraktikantinnen und Schulpraktikanten für die Laufbahn der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an Förderschulen – RdErl. d. Kultusministeriums vom 16.1.1984)
Von der Unterhaltsbeihilfe und den eventuellen Zuschlägen müssen Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Krankenkasse und ggf. Kirchensteuer bezahlt werden. Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung fallen nicht an.
Fachlehrer und Fachlehrerinnen in Ausbildung sind sozialversicherungsfrei beschäftigt. Sie bezahlen lediglich Lohn- und Kirchensteuer, jedoch keine Sozialabgaben. Daher haben sie auch nach bestandener oder endgültig nicht bestandener Prüfung und dem damit verbundenen Ausscheiden aus dem Ausbildungsverhältnis keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Nach dem Ausscheiden aus dem Ausbildungsverhältnis werden alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbildung in der Rentenversicherung nachversichert, wenn der Betroffene nicht innerhalb von zwei Jahren nach Ausscheiden verbeamtet wird. Wenn der Betroffene nach dem Ausscheiden für sich selbst ausschließt, jemals wieder in ein versicherungsfreies Beschäftigungsverhältnis einzutreten, erfolgt die Nachversicherung innerhalb von drei Monaten nach Ausscheiden.
Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbildung haben einen Anspruch auf Beihilfe im Krankheitsfalle – nicht zu verwechseln mit der Unterhaltsbeihilfe. Es besteht die Möglichkeit sich privat oder gesetzlich zu versichern. Was günstiger ist, müssen Sie im Einzelfall selbst klären.
Die Beihilfe bezahlt bei privat ausgestellten Rechnungen in der Regel 50 % des Rechnungsbetrages. Die andere Hälfte wird von der privaten Krankenkasse erstattet. Jede private Krankenkasse überprüft das Risiko des Versicherungsnehmers und legt entsprechend des individuellen Risikos den Beitragssatz fest. Familienmitglieder werden nicht kostenlos mitversichert.
Da der Beihilfeanspruch gegenüber dem Dienstherrn - dem Land NRW - besteht, zahlt dieser keinen Beitrag zur gesetzlichen Krankenkasse, wie es sonst üblicherweise der Arbeitgeber macht.
Das bedeutet, dass der Beitrag zur gesetzlichen Krankenkasse zu 100% selber übernommen muss, wenn statt einer privaten Kasse, der Verbleib in der gesetzlichen Kasse gewählt wird.
Das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis ist ein beamtenähnliches Verhältnis. Nebentätigkeiten bedürfen einer besonderen Genehmigung durch die Bezirksregierung.
Änderungen aufgrund von neuen Verordnungen und Erlassen des MSB hinsichtlich der Ausbildungsstandorte, der Zugangsvoraussetzungen sowie der Organisation der Ausbildung sind grundsätzlich nicht auszuschließen.
Mit der Absolvierung der Ausbildung ist eine Übernahme in den Landesdienst nicht garantiert. Vielmehr kann eine Einstellung nur im Rahmen freier und besetzbarer Stellen im Lehrereinstellungsverfahren erfolgen.