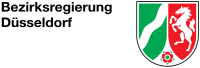Die Bezirksregierung als ehemalige NS-Täterbehörde
Die Bezirksregierung Düsseldorf war während der NS-Zeit (1933–1945) maßgeblich an der Umsetzung nationalsozialistischer Verbrechen beteiligt. Sie trug durch ihre Strukturen und ihr Personal aktiv zur Verfolgung, Enteignung und Entrechtung vieler Menschen, insbesondere jüdischer Bürgerinnen und Bürger, bei.
Diese dunkle Vergangenheit verpflichtet uns als Behörde zu einer kritischen Auseinandersetzung mit unserer Geschichte. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verbrechen der NS-Zeit aufzuarbeiten und an die Opfer zu erinnern.
Die Gestapo in Düsseldorf
Nach der Machtübernahme 1933 wurde der Bezirksregierung die Zuständigkeit für die politische Polizei entzogen und an die Gestapo übergeben. Diese war zunächst im alten Stadthaus an der Mühlenstraße, ehemals Jesuitenkolleg, untergebracht. Heute hat hier die Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf ihren Sitz.
Im März 1936 wurde die Gestapo in das Gebäude des Regierungspräsidiums an der Cecilienallee verlegt. Die Gestapo arbeitete somit im selben Haus mit dem Regierungspräsidium zusammen. Nach dem Umzug in die Prinz-Georg-Straße 94-98 entwickelte sie sich zur zweitgrößten Gestapo-Leitstelle im Deutschen Reich.
Die Bezirksregierung unterstützte die Gestapo aktiv, indem sie Personal und Verwaltungsstrukturen bereitstellte und sich dadurch an ihren Verbrechen beteiligte.
Einrichtung des sogenannten Judenreferats
Eine Schlüsselrolle in der antisemitischen Verfolgung spielte das 1935 eingerichtete „Judenreferat", geleitet von Viktor Humpert, einem überzeugten Nationalsozialisten. Das „Judenreferat“ war maßgeblich an der systematischen Verfolgung jüdischer Bürgerinnen und Bürger beteiligt und setzte antisemitische Maßnahmen durch, darunter:
- Passkontrollen, Hausdurchsuchungen, Verhöre und Verhaftungen
- Die vollständige Enteignung jüdischen Eigentums
- Die Organisation der Deportationen jüdischer Bürger*innen in Konzentrations- und Vernichtungslager
Diese Maßnahmen dienten dem Ziel der völligen Auslöschung der Existenz jüdischer Personen und jedem Hinweis darauf in der Stadtgesellschaft.
Die Bezirksregierung koordinierte und unterstützte zahlreiche Maßnahmen, die zur systematischen Ausgrenzung, Verfolgung und Deportation von Jüdinnen und Juden, politischen Gegnerinnen und Gegnern, Sinti und Roma sowie von sogenannten „asozialen“ Menschen im Kontext des NS-Regimes führten.
Die enge ideologische Prägung der Verwaltung zeigt sich auch in der Parteizugehörigkeit ihrer Mitarbeiterschaft: Etwa 75 % der Beamtinnen und Beamten der Bezirksregierung Düsseldorf waren Mitglieder der NSDAP. Diese hohe Quote veranschaulicht die starke Verflechtung der staatlichen Verwaltung mit dem nationalsozialistischen Regime und dessen menschenverachtender Ideologie.
Die Rolle der Bezirksregierung bei der Reichspogromnacht 1938
Bei der Planung und Durchführung der gewalttätigen Ausschreitungen während der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 spielte die Bezirksregierung eine zentrale Rolle.
Auf Anweisung des Oberregierungsrats August Korreng und des SS-Obergruppenführers Fritz Weitzel übermittelte die Behörde eine Direktive des Reichsinnenministeriums mit sieben Handlungsanweisungen an Kommunen, Polizei- und Gestapodienststellen. Eine dieser Vorgaben untersagte ausdrücklich jegliche Versuche, die Übergriffe zu unterbinden.
Nach 24:00 Uhr gaben Korreng und Weitzel den Schutzpolizeien der Kommunen per Blitzfernschreiben weiter:
„dass ab sofort Demonstrationen und Aktionen gegen Juden unternommen werden. Hiergegen ist nicht einzuschreiten. Die Aktionen sind im Gegenteil zu unterstützen. Wertsachen, die beim Einschlagen von Schaufensterscheiben usw. evtl. durch Mob geplündert werden, sind von den Polizeirevieren sicherzustellen. Es ist damit zu rechnen, dass Synagogen in Flammen hochgehen.“ (August Korreng, Fritz Weitzel)
Eugen Cohen, Sohn der damals 75-jährigen Düsseldorferin Eva Cohen, erinnerte sich 1960 an die grauenhaften Ereignisse der Pogromnacht in Düsseldorf zurück:
„In der Kristallnacht wurde das Haus meines Bruders, Graf-Recke-Straße 49 am Zoo, völlig zerstört, ebenso die Wohnung meiner Eltern, Rather Straße 56, welche kurz vorher ihre Goldene Hochzeit bei bester Gesundheit hatten feiern können. An den Folgen der schweren Misshandlungen starb meine Mutter völlig gelähmt nach langen Qualen.“ (Eugen Cohnen)
Deportationen aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf
Schon mit Beginn der NS-Diktatur kam es zu gewaltsamen Übergriffen, erzwungenen Fluchten und Morden an Jüdinnen und Juden. Die jüdische Bevölkerung Düsseldorfs schrumpfte zwischen 1933 und 1939 von 5.053 auf nur noch 1.813 Personen.
Ab Herbst 1941 organisierte die Bezirksregierung die systematischen Deportationen jüdischer Personen. Die verantwortlichen Beamtinnen und Beamten erstellten Namenslisten, enteigneten Vermögenswerte und koordinierten die Zwangsverschleppungen in Zusammenarbeit mit Polizei und Finanzbehörden.
Die „Sammlung" der Menschen erfolgte an der Großschlachthalle des städtischen Schlacht- und Viehhofs in Düsseldorf-Derendorf, wo sie häufig Misshandlungen und Diebstählen der Beamten ausgesetzt waren. Von dort wurden die Menschen unter grauenhaften Bedingungen über den Derendorfer Güterbahnhof in Ghettos und Vernichtungslager wie Minsk, Riga, Theresienstadt und Auschwitz deportiert. Bis Kriegsende fielen etwa 7.000 Menschen diesen Maßnahmen zum Opfer.
Nach 1945: Aufarbeitung und Kontinuitäten
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Auseinandersetzung mit der Rolle der Bezirksregierung in der NS-Zeit nur zögerlich vorangetrieben. Zwar wurden einige Beamte entlassen, doch viele kehrten mit „Persilschein“ oder „Miläuferstempel“ zurück, darunter auch hochrangige NS-Funktionäre. Die letzten von ihnen gingen erst in den 1980er Jahren in den Ruhestand. Einige, die an Verfolgungsmaßnahmen beteiligt waren, stiegen in höhere Ämter auf. Die Entnazifizierung war ein chaotischer Versuch, der aufgrund mangelnder Alternativen und der tiefen Verstrickung der Bevölkerung in die NS-Ideologie scheiterte. Auch die Entschädigung der Opfer wurde anfangs nur chaotisch umgesetzt. Das Engagement von Opferverbänden und der internationalen Gemeinschaft trugen jedoch dazu bei, Versäumnisse nachzuholen.
Erinnern heißt Verantwortung übernehmen
Heute setzt sich die Bezirksregierung Düsseldorf aktiv mit ihrer Vergangenheit auseinander und arbeitet eng mit der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf zusammen. Die Aufarbeitung der eigenen Geschichte ist ein wesentlicher Bestandteil der Erinnerungskultur dieser Behörde.
Die Vergangenheit mahnt uns, demokratische Werte zu schützen und wachsam gegenüber allen Diskriminierungen und Vernichtungsideologien zu sein. Nur durch eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte können die Grundwerte von Demokratie, Menschenrechten und Freiheit nachhaltig gestärkt werden.
Führungen:
Die Bezirksregierung bietet in regelmäßigen Abständen Führungen zur Geschichte der ehemaligen NS-Täterbehörde an. Die nächste Führung findet am 14. Mai um 16:00 Uhr statt. Treffpunkt ist der Lichthof der Bezirksregierung. Sprechen Sie unser Personal bei Interesse gerne an.